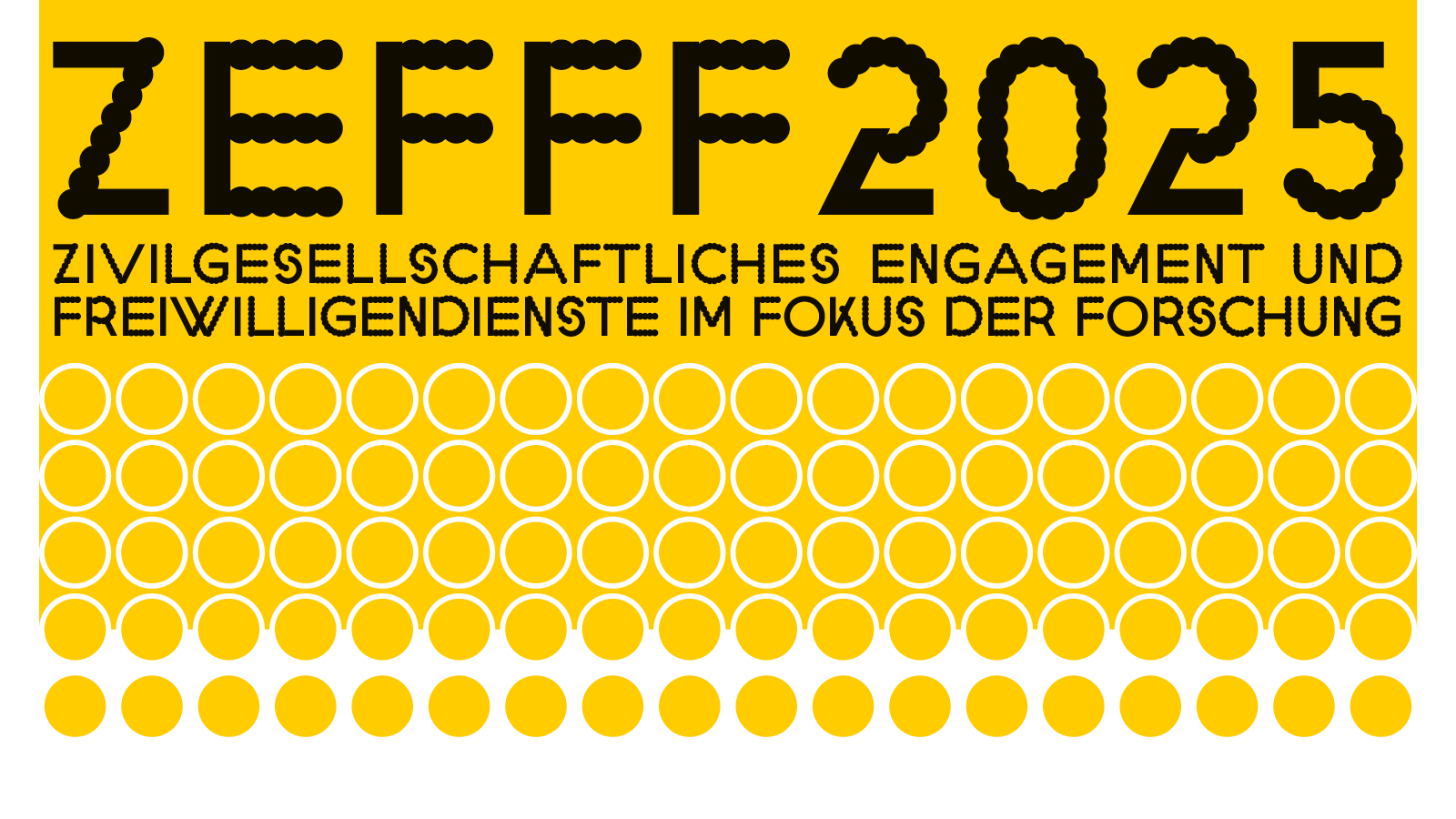Umbruch, Druck, Transformation? – Gegenwart und Zukunft des Engagements
2. ZEFFF Tagung – Zivilgesellschaftliches Engagement und Freiwilligendienste im Fokus der Forschung
What’s up? Wie gehts Engagement?
Dieser und weiteren Fragen werden wir wissenschaftlich nachgehen und diskutieren. Wie steht es um das Engagement und die Freiwilligendienste? Welche Kräfte und Mechanismen prägen aktuell das Engagement und die Freiwilligendienste? Welche Chancen und Herausforderungen bestimmen ihre Zukunft?
Einladende
Wir, das sind der Voluntaris e.V., der die ZEFFF ins Leben gerufen hat, und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE). Die Tagung findet in Kooperation mit der Geschäftsstelle des IV. Engagementberichts der Bundesregierung an der Universität Siegen und dem Förderverein Zivilgesellschaftsforschung e.V. statt.
KEYFACTS und Anmeldung
Wo?
Alte Münze, Berlin
Molkenmarkt 2, 10179 Berlin
Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zugänglich.
Es wird gebeten, individuellen Unterstützungsbedarf bei der Anmeldung anzugeben.
Wann?
Donnerstag, 6. März 2025
Tagung von 10 Uhr bis 17.30 Uhr
Abendveranstaltung von 17.30 bis 21 Uhr
Freitag, 7. März 2025
Tagung von 9 bis 14.30 Uhr
Tagungsgebühr
Über den Anmeldelink wird zunächst ein “Gratis Ticket” ausgestaltet. Die finale Anmeldung ist erst nach Errichtung der Tagungsgebühr an den Voluntaris e.V. bestätigt. Weitere Informationen zur Staffelung der Tagungsgebühren sind unterhalb des Programms vermerkt.
Programm
Über unseren Call haben wir viele Einreichungen bekommen – vielen Dank dafür. Wir konnten so ein interessantes Programm zusammenstellen. Euch erwarten neun Panels mit jeweils drei wissenschaftlichen und fachlichen Inputs. Den thematischen Bogen spannen drei Rednerinnen und Redner in ihren Keynotes auf. Am ersten Tag inspiriert euch Prof. Dr. Chantal Munsch, Vorsitzende der Sachverständigenkommission des Vierten Engagementberichts der Bundesregierung. Zwei weitere Keynotes halten am Freitag Dr. Manès Weisskircher, Head of the Research Group REXKLIMA an der Technischen Universität Dresden und Prof. Dr. Marc Redepenning von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
Kooperation und Netzwerke sind zentrale Bausteine für Wissens- und Erfahrungsaustausch. Deshalb legen wir bei der ZEFFF besonderen Wert auf vielfältige Möglichkeiten zur Begegnung und zum Dialog. Neben informellen Gesprächen in den Pausen laden wir euch ein, bei der Abendveranstaltung am Donnerstag in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in der Praxis genutzt werden können. Eine Netzwerkbörse am Freitag bietet außerdem einen strukturierten Rahmen, um gezielt mit Akteuren aus Wissenschaft und Praxis ins Gespräch zu kommen und gemeinsame Perspektiven zu entwickeln.
Das Programm als Download, hier.
Donnerstag, 6. März 2025
ab 10.00 Uhr Anmeldung
11.00 Uhr Beginn der Tagung / Begrüßung
11.15 Uhr KEYNOTE
Einblicke in den Vierter Engagementbericht der Bundesregierung,
Prof. Dr. Chantal Munsch, Universität Siegen
11.45 Uhr DISKUSSION
Perspektiven zum Engagementbericht aus Österreich, der Schweiz und Deutschland
Moderation: Benjamin Haas
- Dr. Paul Rameder, Wirtschaftsuniversität Wien, Social Entrepreneurship Center
- Prof. Dr. Georg von Schnurbein, Universität Basel, Center for Philanthropy Studies
- PD Dr. habil. Tuuli-Marja Kleiner, Thünen Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen
- Prof. Dr. Chantal Munsch, Universität Siegen
12.45 Uhr Mittagessen
13.45 Uhr Panel Session 1
A - Perspektiven auf ein Gesellschaftsjahr
Moderation: Dr. Katharina Mangold
Freiwilliges Engagement oder gesellschaftlicher Pflichtdienst?
Dr. Holger Backhaus-Maul, Lina Hehl, Klara Kümpfel, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg
Die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres wird kontrovers diskutiert. Während sich die bisherigen Debatten auf sicherheits-, gesellschafts- und arbeitsmarktpolitische Aspekte konzentrieren, stellt dieses Panel andere Blickwinkel in den Vordergrund. Zunächst liefert es Grundsätzliches zu den Themen Freiwilligkeit und Pflicht und zeichnet systematisch die kontroversen Positionen unterschiedlicher Akteur:innen und die ihnen zugrundeliegenden Begründungen nach.
Der journalistische Sound der Dienstpflicht-Debatte – Die Platzanweiser
Dr. Gerd Placke, Bertelsmann Stiftung
Ein Blick auf den „journalistischen Sound“ der Diskussion macht deutlich, welche Kräfte und Mechanismen in der Dienstpflichtdebatte wirken und zeigt, wie Publizierende ausgewählter Leitmedien freiwilliges Engagement einem Rechtfertigungsdruck aussetzen.
Der Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst als jugendpolitische Antwort in der Pflichtdienstdebatte: Zugangshürden senken und Teilhabe ermöglichen
Dr. Jörn Fischer, Universität Köln
Ein Rechtsanspruch auf ein Gesellschaftsjahr soll sowohl Zugangshürden abbauen als auch die Finanzierung von Freiwilligendiensten langfristig sichern. Statt „alle müssen“ gilt der Grundsatz: „Alle müssen können“.
B - Engagement und soziale Ungleichheit
Moderation Prof. Dr. Andrea Walter
Geschlechterunterschiede im Engagement in ländlichen Räumen
PD Dr. habil. Tuuli-Marja Kleiner, Dr. Sylvia Keim-Klärner, Thünen-Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen, Braunschweig
Nicht alle Bevölkerungsgruppen sind gleichermaßen an Engagement und Freiwilligentätigkeiten beteiligt. Unsere Auswertung von Daten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) und des Freiwilligensurveys (FWS) zeigt, dass sich in den letzten 20 Jahren geschlechtsspezifische Unterschiede im Engagement in ländlichen Räumen teilweise verringert haben. Der Anteil engagierter Frauen ist deutlich angewachsen, jedoch engagieren sie sich weiterhin seltener als Männer und in unterschiedlichen Engagementbereichen.
Die Welt bewegen, einander etwas Gutes tun oder unter Gleichen sein? – Wirkungsebenen des Engagements in Selbstorganisationen marginalisierter Personen in Deutschland
Dr. Johanna Treidl und Katharina Batzing, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft
Der Beitrag rückt die Perspektive marginalisierter Menschen auf ihr Engagement in Selbstorganisationen in den Forschungsfokus. Welche Intentionen verfolgen sie als Aktive des Engagements? Auf Grundlage qualitativer Interviews und mithilfe eines Analyserasters, das drei Wirkungsebenen von Engagement unterscheidet, wird deutlich, dass das Engagement von Marginalisierten (oft unbeabsichtigt) auf mehreren Wirkungsebenen gleichzeitig ansetzt und biografisch nicht linear verläuft.
Dynamiken, Herausforderungen und Forschungslücken – Engagement und Diskriminierung
Prof.‘in Dr. Sabrina Zajak, Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung; Prof. Dr. Serhat Karakayali, Leuphana Universität Lüneburg; Fabio Best, Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung
Zivilgesellschaftliches Engagement wird als zentraler Motor für gesellschaftliche Teilhabe und den Abbau sozialer Ungleichheiten gesehen. Gleichzeitig sind besonders Menschen mit Migrationshintergrund oder ohne deutsche Staatsbürgerschaft im Engagement stark unterrepräsentiert – was unter anderem mit Diskriminierungserfahrungen in Verbindung gebracht werden könnte. Allerdings fehlen bislang verlässliche Daten, die beleuchten, wie Diskriminierungserfahrungen mit Engagement zusammenhängen. Um diese Lücke zu schließen betrachtet unser Beitrag u.a. Diskriminierungserfahrungen im Engagement, wahrgenommene Hürden sowie die Rolle von Rekrutierungsnetzwerken. Dabei wird ein breiter Engagementbegriff zugrunde gelegt, um auch informelle und migrantische Engagementformen, die bisher oft übersehen werden, zu berücksichtigen.
C – Engagement im Kontext von Biografien, Lernen und Bildung
Moderation: Dr. Siri Hummel
Das gallische Dorf in der Engagementlandschaft: Wie soziales Mentoring dem Formwandel des Engagements trotzt und was sich daraus lernen lässt
Dr. Behzad Förstl, Malica Christ, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
Zivilgesellschaftliche Organisationen kämpfen oft mit sinkenden Engagiertenzahlen, da sich Menschen zunehmend kurzfristig und flexibel außerhalb etablierter Strukturen engagieren. Soziales Mentoring widersetzt sich diesem Trend und gewinnt als Engagementform im Kontext von gesellschaftlicher Teilhabe und der Verbesserung von Bildungschancen insbesondere bei marginalisierten Gruppen deutschlandweit an Bedeutung. Der Beitrag zeigt, welche Faktoren auf struktureller und individueller Ebene langfristiges Engagement in Mentoring-Programmen fördern und welche Erkenntnisse daraus für andere Engagementbereiche abgeleitet werden können.
Entwicklungen und Trends in der berufsbezogenen Freiwilligenarbeit für junge Zugewanderte
Prof. Dr. Nicole Pötter, Bernhard Scholze, Theresa Grüner, Hochschule München University of Applied Science
Zugewanderte am Übergang Schule-Beruf waren und sind besonders stark von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen. Die Unterstützung durch Freiwillige hilft dabei, Bildungserfolge zu sichern. Im Rahmen des laufenden Forschungsprojekt LokU 2.0 werden Ergebnisse zu (post)pandemischen Entwicklungen und Trends der berufsbezogenen Freiwilligenarbeit vorgestellt, die auf Interviews mit Koordinierenden im Ehrenamt sowie einer bundesweiten Delphi-Befragung von Akteurinnen und Akteuren lokaler Unterstützungsketten basieren.
Lernen im Engagement: Neue Einblicke aus einem Mixed-Methods Design
Inger Kühn, Julia Bartel, ZiviZ im Stifterverband
Freiwilliges Engagement gilt als Ort des Kompetenzerwerbs, doch konkrete Lerneffekte und Engagementfeld- sowie altersspezifische Unterschiede sind bisher wenig erforscht. Die Studie „Lernen im Engagement“ untersucht mithilfe eines Mixed-Methods-Designs Lernerfahrungen und den Erwerb demokratischer Kompetenzen aus Sicht Engagierter und Organisationen. Analysiert werden Daten des ZiviZ-Surveys 2023, des Freiwilligen-Surveys 2019 und 30 Interviews. Ziel ist es, praxisnahe Empfehlungen für die Engagement- und Demokratieförderung zu entwickeln.
15:15 Uhr Kaffeepause
16 Uhr Panel Session 2
A - Engagement für alle
Moderation: Jana Priemer
Im Panel geht es um die Frage, wie unter den veränderten Bedingungen einer Migrations- und Arbeitsgesellschaft Engagement möglich bleiben kann. Wie lässt sich der positive Horizont einer Gesellschaft, in der es allen möglich ist, sich zu engagieren, aufrechterhalten? Ziel des Panels ist es, aus marginalisierten Perspektiven konkrete Schritte auf dem Weg zum „Engagement für alle“ zu entwickeln.
Freiwilliges Engagement aus einer arbeitssoziologischen Perspektive begreifen
Carolin Mauritz, Frankfurt University of Applied Sciences /Freiwilligenzentrum Offenbach /Institut für Sozialforschung Frankfurt
Wir gestalten Zukunft! Die transformative Kraft migrantischer Selbstorganisationen und ihrer Dachverbände
Winona Hagendorf, Kompetenzzentrum Vielfalt Hessen/berami e.V.
Lydia Mesgina, Projekt Moses Jugend- und Sozialwerk e.V.
Was kann ich? Empowerment und Engagement in der Arbeit mit Erwerbsarbeitslosen
Stefan Lerach, Geschäftsführung Arbeitsloseninitiative im Lahn-Dill-Kreis e.V./WALI
B - Engagementverlauf
Moderation: Dr. Andreas Kewes
Attraktivität des Ehrenamts im Katastrophenschutz: Soziales Miteinander als Schlüssel?
Svenja C. Schütt, Elisabeth Kals, Bernadette Enders, Laura Pollack, Isabel Strubel, Susanne Freund, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Die Studie mit über 8500 Teilnehmenden untersucht, was das Ehrenamt im Katastrophenschutz attraktiv macht. Freude am Ehrenamt und ein positiv erlebtes soziales Miteinander stehen Herausforderungen wie starren Strukturen und hohen zeitlichen Anforderungen gegenüber. Die Studie liefert praxisorientierte Impulse, wie ein Ehrenamt durch die Förderung von Gemeinschaft und organisatorische Veränderungen, bspw. unterstützt von internen Multiplikator:innen, nachhaltig gestärkt werden kann.
Engagement unter Druck - Engagementabbrüche verstehen und selbstbestimmteTätigkeiten fördern
Malina Küster, HAWK Holzminden & Zukunftszentrum Holzminden-Höxter
Der theoretische Ansatzpunkt des Beitrags ist eine soziologische Engagementtheorie rund um den Eigensinn. Der Input dient als Einführung dieser Theorie und zeigt, wie wichtig Selbstbestimmung im Rahmen von Engagement ist. Denn bleiben die selbstbestimmten Tätigkeiten während des Engagements aus, kommt es früher oder später zu Engagementabbrüchen. Anhand eines Fallbeispiels werden die wesentlichen Aspekte der Theorie erläutert und dabei veranschaulicht, wie ein Engagementabbruch verlaufen kann.
Wahrgenommene Zugangsbarrieren Engagementinteressierter in Sportvereinen
Carina Post, Sören Wallrodt, Lutz Thieme, Hochschule Koblenz
Seit Jahrzehnten wird ein Rückgang des Ehrenamts in Sportvereinen beschrieben. Dem Rational-Choice-Ansatz folgend, erfolgt ein Match zwischen Verein und Person, wenn beidseitig entscheidungsrelevante Informationen kommuniziert werden und Personen einen positiven Nutzen unter Berücksichtigung der Opportunitätskosten erwarten. Die Studie untersucht die Anbahnungsphase zum Ehrenamt basierend auf Interviews mit Ehrenamtsinteressierten (n=17) und einer Vorstandsbefragung (n=3.682).
C - Engagement und ländliche Räume
Moderation: Mirko Winkelmann
Herausforderungen für die lokale Demokratie(förderung): Perspektiven und Bewältigungspraktiken zivilgesellschaftlicher Akteure im ländlichen Raum in Thüringen
Prof. Stefanie Kessler, Vivien Dos Anjos, Internationale Hochschule
Zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure in Thüringen erleben politisch unsichere Zeiten und einen Rechtsruck. Der Beitrag beleuchtet die Herausforderungen, vor denen sie in der lokalen Demokratieförderung gestellt werden und ihre Umgangsweisen damit. Gruppendiskussionen aus 2024 zeigen, dass einige Herausforderungen angegangen werden, während andere ungelöst bleiben. Vorgestellt werden Handlungsmöglichkeiten, vorhandene Ressourcen und offene Fragen.
Ehrenamt und Alter(n): Neue Formen freiwilligen Engagements in ländlichen Kommunen
Sara Lüttich, Universität Gießen
Der demografische Wandel fordert ländliche Regionen heraus, neue Wege im Ehrenamt zu beschreiten. Ein Forschungsprojekt in Laubach, Landkreis Gießen, stellt Erkenntnisse vor, wie ältere Menschen als aktive Mitgestaltende soziale Werte wie Gemeinwohl und Solidarität fördern können. Im Fokus stehen innovative Ansätze, die konventionelle Strukturen ergänzen, und die Rolle der Kommunalpolitik bei der Entwicklung einer zukunftsfähigen Engagementkultur.
Ehrensache Hauptamt – Hauptsache Ehrenamt?! Chancen, Grenzen, Synergien und Herausforderungen für Haupt- und Ehrenamt in Regionalmuseen Mitteldeutschlands
Nick Petukat, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Museen und Ausstellungen in ländlichen Räumen stehen angesichts rückläufiger Kommunalförderung vor herausfordernden Zukunftsperspektiven und bangen zusätzlich um ehrenamtlichen Rückhalt. Auf Basis eines Mixed-Methods-Verfahrens erörtert der Beitrag, wie die Verteilung musealer Kernarbeit zwischen hauptamtlich Mitarbeitenden sowie ehrenamtlich Aktiven strukturiert ist, welche Bedarfe und Potentiale bestehen, wie Synergien funktionieren sowie welche Chancen und Grenzen Ehrenamt aufweisen.
17.30 Uhr Abendprogramm
17.30 Uhr EMPFANG: Engagement und Freiwilligendienste: Ein interdisziplinärer Dialog
- Vorstellung des neuen Handbuchs für Wissenschaft und Praxis (Voluntaris und Nomos Verlag)
- Ein Blick aus der Praxis: Tobias Kemnitzer, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V.
- Austausch und Netzwerken
18.00 Uhr Abendbuffet
21.00 Uhr Ende
Freitag, 7. März 2025
09.00 Uhr Ankunft und Anmeldung
09.15 Uhr Begrüßung
09.30 Uhr KEYNOTE: Die Politisierung der Zivilgesellschaft im Kontext neuer gesellschaftlicher Konfliktlinien
- Dr. Manès Weisskircher, Technische Universität Dresden
10.15 Uhr PANEL SESSION 3
A – Engagement und Jugenden
Moderation: Nicole Vetter
Die kleinen Dinge im Leben. Ist die Aushandlung- und Interaktionspraxis in jugendlichen Peergroups schon Engagement?
Ninja Bandow, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Der Begriff des Engagements wird, aufgrund des stark ausgeprägten Öffentlichkeitsbezugs, als Voraussetzung für Anerkennung oft normativ gefasst und macht ‚stille Engagementformen‘ unsichtbar. Ziel des Beitrags ist es, anhand von Gruppendiskussionen zu verdeutlichen, wie relevant alltägliche Aushandlungsprozesse sind und inwiefern durch unterschiedliche Bezugnahmen zur sozialen Umwelt gemeinsame Anfänge zum Handeln und Sprechen gesetzt werden.
Jugendliches Engagement angesichts von Nicht-Anerkennung und Frust
Kilian Hüfner, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Engagement schafft Teilhabe und gesellschaftliche Mitgestaltung, insbesondere für junge Menschen. Dennoch finden jugendliche Engagementpraktiken häufig kaum Anerkennung, was soziale Exklusion sowie Misstrauen in sozialen und politischen Strukturen fördern kann. Der Vortrag beleuchtet, wie Machtstrukturen und Anerkennungsverhältnisse Engagement beeinflussen und warum Wertschätzung jugendlichen Engagements sogar essenziell für sozialen Zusammenhalt und politische Partizipation ist.
Wo kann man sich eigentlich wie engagieren? Stellenwert des Biographischen in Kontexten queeren Engagements
Patrick Leinhos, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
In diesem Beitrag werden aus biographischen Interviews, rekonstruierte Umgangsweisen junger Erwachsener mit institutionalisierten Erwartungen in Kontexten queeren Engagements typisiert. Auf diese Weise werden normative Verständnisse von Engagementmodi und die Rolle des Biographischen, der Persönlichkeit und persönlicher Belange in politischem Engagement, Vereinsarbeit und queerer Bildung herausgearbeitet. Damit soll festgestellt werden, wo man sich eigentlich wie engagieren kann.
B – Engagement und gesellschaftliche Herausforderungen
Moderation: Dr. Vivian Schachler
Der Monitor Unternehmensengagement 2025: Neue Einblicke in das gesellschaftliche Engagement der deutschen Wirtschaft
Dr. Peter Schubert, David Kuhn, ZiviZ im Stifterverband
Krise als Chance? Strategien und Handlungspläne zur Stärkung des freiwilligen Engagements in Krisenzeiten
Nuria Catalán, Linda Spadolini und Prof. Dr. Heinz Stapf-Finé, Europa-Institut an der ASH Berlin e.V.
Gefördert durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin untersucht das Europa-Institut für Sozial- und Gesundheitsforschung – ein An-Institut der Alice Salomon-Hochschule – in den Bereichen Flucht/Migration und Wohnungslosenhilfe Auswirkungen der Corona- und nachfolgender Krisen auf freiwilliges Engagement. Ziel ist es, Strategien zur Stärkung der Resilienz zu entwickeln und das Fortbildungsangebot für Freiwillige und deren Koordinator:innen zu verbessern.
Von Krisenbewältigung zu Transformation: Resilienz als Schlüsselkompetenz zivilgesellschaftlicher Organisationen
Dr. Josefa Kny, betterplace lab
Die Resilienz zivilgesellschaftlicher Organisationen ist entscheidend, um gesellschaftliche Krisen zu bewältigen und langfristige Transformation zu fördern. Unsere Studie zeigt auf, dass Resilienz keine unveränderbare Eigenschaft ist, sondern durch gezielte Stärkung von Ressourcen erlernt und verbessert werden kann. Im empirischen Teil offenbart sie Stärken in den Ressourcenclustern zu Sinn und Zusammenhalt, während Schwächen in den Feldern Führung, Lernkultur und materiellen Ressourcen liegen.
C – Freiwilligendienste
Moderation: Dr. Katharina Mangold
Das Europäische Solidaritätskorps zwischen Anspruch und Wirklichkeit; Ansätze und Wirkungen zur Stärkung von freiwilligem Engagement in Zeiten der Krise
Eva Feldmann-Wojtachnia, Ludwig-Maximilians-Universität München
Die Sorgen junger Menschen sind angesichts der multiplen Krisenlage gravierend und demokratische Werte wie Vielfalt, Solidarität und soziale Gerechtigkeit nicht mehr selbstverständlich. Um dem entgegenzuwirken, unterstützt die EU die aktive Partizipation Jugendlicher mit dem Europäischen Solidaritätskorps. Der Beitrag diskutiert, inwieweit dies freiwilliges Engagement wirkungsvoll befördert, die europäische Identität und aktive Bürgerschaft stärkt und den Bedürfnissen junger Menschen und ihren Ideen für die Gestaltung der Gesellschaft gerecht wird.
Erfahrungen im Freiwilligendienst vermittelt von den Freunden der Erziehungskunst
Babett Rampke, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.,
Dr. Jürgen Peters, Alanus Hochschule
Was war die wichtigste Erfahrung des Freiwilligendienstes (FWD)? Welchen Effekt hat der FWD auf die Berufswahl? Wie werden persönliche Entwicklung und gesellschaftsrelevante Werte beeinflusst? Zum 30-jährigen Jubiläum untersuchten die Freunde Waldorf die Wirkung ihrer FWD. Die Antworten von 1600 Alumni aus 30 Jahren Auslands-, Incoming- und Inlands-FWD geben aufschlussreiche Einblicke in die rückblickende Bewertung des Dienstes und dessen Bedeutung auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene.
Das transformative Potential von internationalem freiwilligen Engagement unter der Lupe – aus einer subjektiven biographischen Perspektive
Franziska Müller, Mechthild Kiegelmann, Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Internationalem Engagement wird eine positiv-verändernde Kraft auf die Freiwilligen zugeschrieben. Dass die Veränderungen nicht per se eintreten, wurde schon diskutiert. Dieser Beitrag zeigt mittels entwicklungspsychologischer Studien, wie Freiwillige ihr Engagement rückblickend als wichtigen Baustein ihres Lebenswegs rekonstruieren. Dabei scheinen Vorerfahrungen von zentraler Bedeutung zu sein. Internationales Engagement sei daher nicht allein schon als Auslöser für Transformation zu werten.
11.45 Uhr Kaffee Pause
12.15 Uhr KEYNOTE: Stärker und weniger formalisierte Engagements: Wie kommen sie in der Praxis vor und wie kann man sie unterstützen?
– Prof. Dr. Marc Redepenning, Otto-Friedrich Universität Bamberg
12.45 Uhr COMMUNITY-TALK: Erkenntnisse der Tagung und wo geht es hin mit der Engagementforschung?
Interaktiver Austausch
Moderation: Dr. Julia Schlicht
13.15 Uhr Lunch-Talk und Netzwerkbörse
14.30 Uhr Ende
Wichtige Information zur Tagungsgebühr
Der Voluntaris e.V. erhebt eine Tagungsgebühr, die nach der Anmeldung an Voluntaris e.V. zu zahlen ist.
Die Tagungsgebühr ist wie folgt gestaffelt:
Kategorie 1: Studierende und Ehrenamtliche (kostenfrei):
Studierende und rein ehrenamtlich Tätige, die nicht in Vertretung einer Organisation an Tagung teilnehmen. Auch in weiteren besonderen Fällen kann ein Erlass der Beiträge geprüft werden (Härtefall).
Kategorie 2: Ermäßigter Beitrag (25 Euro):
Angehörige des wissenschaftlichen Mittelbaus (bspw. Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen, Personen in der Qualifikationsphase oder ohne Professur), freiberuflich Tätige (bspw. Trainer:innen) sowie Vertreter:innen rein ehrenamtlich tätiger Organisationen.
Kategorie 3: Regulärer Beitrag (40 Euro):
Professor:innen, Vertreter:innen von Organisationen mit hauptamtlicher Struktur und Firmen.
Ansprechpersonen
Prof. Dr. Andrea Walter
Dr. Julia Schlicht
Teamleitung
Forschung und Wissenstransfer